Architektur
Bachelor und Master
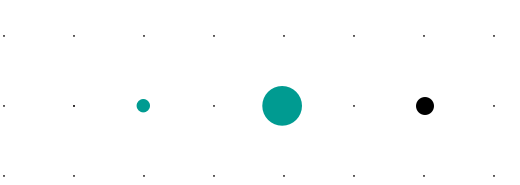
Alltag und spekulative Gestaltung
(5/23) Prof. Anna Kubelík nahm das Publikum bei ihrer Antrittsvorlesung mit auf eine Rückschau ihrer bisherigen Arbeiten und gab einen Überblick über das Fach künstlerisch-experimentelle Darstellung und Gestaltung – insbesondere den Bereich der spekulativen Architektur.

Zu Beginn ihres Vortrags mit dem Titel »Henne oder Ei? Was war zuerst da und wie geht es weiter« ging Prof. Anna Kubelík direkt ein auf ebenn jene essentielle Frage der Evolutionsgeschichte. Diese Frage, die bei ihr gelegentlich beim Frühstück kommt, löse eine Alltagsbeobachtung aus und damit einhergehend eine Haltung des ständigen Hinterfragens trivialer Dinge. Im ersten Teil der Antrittsvorlesung nahm Anna Kubelík Bezug auf den langen, etwas sperrigen Titel des Fachs, das sie an der HTWG seit dem Sommersemester 2022 unterrichtet: Künstlerisch-experimentelle Darstellung und Gestaltung.
Wie es der Titel vermuten lässt, lässt der Fachbereich vielfältige Interpretationsmöglichkeiten zu. Immer verbunden mit der Frage nach dem Verständnis der einzelnen großen Begriffe Kunst, Darstellung, Experiment und Gestaltung. Diese Begriffe wurden als Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von Anna Kubelík daher zunächst definiert. Der größte Unterschied der Kunst zu Architektur, sei, so Kubelík, dass die Kunst ganz aus sich selbst heraus entstehe, die Architektur dagegen zumeist aus einem Auftrag hervorgeht. Die Kunst möchte immer wieder in der Zeit, in der sie sich bewegt, Neues entdecken und aufspüren, hinterfragt kritisch politische und gesellschaftliche Entwicklungen, hilft dabei, Unsichtbares sichtbar zu machen, um die Welt und ihre Beziehungen besser zu verstehen. Im Kontext einer Hochschule bestimme neuerdings die sogenannte Artistic Research die Debatte. Im Kern steht die Frage, ob es sich dabei um eine tatsächlich neue, genuin zwischen Kunst und Wissenschaft angesiedelte Forschungspraxis handelt, eine auf empirische Forschung aufbauende Wissenschaft, oder sie sich (was in der künstlerischen Gestaltung oft der Fall ist) auf die Sinne beruft. Diese beiden Ansätze stehen konträr zueinander.
Als Beispiel der zeitgenössischen Entwicklung in der Kunst gab Anna Kubelík Einblicke in das Schaffen von Refik Anadol, dessen Arbeiten häufig aus datengesteuerten maschinellen Lernalgorithmen bestehen, die aus Datenströmen immersive, traumähnliche Umgebungen schaffen. Refik Anadol programmiert seine Bilder, bewegt sich damit im öffentlichen, städtischen Raum und schafft so eine Verbindung zur Architektur. Ein weiteres von Anna Kubelík angeführtes Beispiel, bei der sich Kunst und Wissenschaft überschneiden, ist das umstrittenene Kunstprojekt Stranger Visions. Die Informationskünstlerin und Biohackerin Heather Dewey-Hagborg schuf Portraits, die sie aus weggeworfenen Gegenständen wie Haare, Zigaretten und Kaugummi zusammengetragen hatte. Aus dem genetischen Material dieser Gegenstände schuf sie Portraits der DNA-Besitzer*innen – und warf so Fragen des Eindringens in die Privatsphäre jedes Einzelnen auf.
Ihr eigenes Arbeits- und Forschungsfeld beschrieb Anna Kubelík mit dem für sie vorrangigen Ansatz, immer wieder Neuland betreten zu wollen und Dinge zu tun, bei denen sie vorher nicht weiß, wie diese aussehen werden, ausgehen werden. Zum Prozess gehöre das Scheitern, ebenso wie das wieder Aufstehen. Wichtig für die eigene Arbeit sei ihr immer der Kontext, das Architekturstudium dabei für ihre Arbeit entscheidend, weil die Suche nach dem Kontext sie entscheidend geprägt habe, dieser sensibilisiere für Bedürfnisse, Farben und Formen. Es geht Anna Kubelík um die Situationen, das Material, die Temperatur, die beteiligten Akteure, das Umfeld – zusammengefasst dem Einbetten der Arbeit in ein vorhandenes Feld. Fragen, die jede* Architekt*in beschäftigen. Und dabei die treibende Kraft einer Geschichte zu finden, die Form, Material, Medium und Dimension festlegt. In der Praxis zeige sich dies in Form von kybernetischen Arbeiten, Studien, Performances, Installationen und Kooperationen mit Musiker*innen und Tänzer*innen. Was daraus alles entstehen kann, das zeigte Anna Kubelík anhand dreier Projekte:
Movigami – Fremde Orte – eine kinetische Konzertinstallation, aufgeführt im Berliner Radialsystem (November 2009). Beim Versuch mit allen Konventionen des klassischen Konzertbesuchs zu brechen, wurde die Architektur in die Performance mit einbezogen. In Form einer gefaltete Decke, die ihre Farbe und Form änderte. Die wellenförmigen Bewegungen wurde von den Musiker*innen selbst gesteuert, indem diese an Seilen zogen, die an den Deckenrändern befestigt waren. So konnten die Musiker*innen den Konzertraum direkt beeinflussen und so ein zusätzliches räumliches Instrument bespielen. Anna Kubelik wählte bei der Frage der Herstellung und des Materials der gefalteten Decke den Ansatz der Faltkunst des Origami. Dazu befasste sie sich mit Robert Lang, Physiker und Weltraumforscher, der Origami als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst betrachtet und eine Software entwickelte, mit der sich jegliche Form falten lässt – und bei der NASA Anwendung findet.
ME + ROME – eine audiovisuell immersive Performance im Berliner Martin-Gropius-Bau (Dezember 2017) mit dem Schriftsteller und Regisseur Tarik Goetzke. Die Arbeit zum Mythos Romulus und Remus gibt dem Publikum die Möglichkeit, die Perspektive eines Familienmitglieds einzunehmen und thematisiert den Streit der beiden Gründer der ewigen Stadt um die Urheberschaft, mit dem Einsatz einer VR-Brille. Das Projekt entstand während eines längeren Aufenthalts in Rom, bei dem die Stadtgründer und der Mythos omnipräsent waren. Die Herangehensweise war eine sehr direkte, unter Einbeziehung von Archäologie und Forschung mithilfe von VR-Technologie – für eine klare Vorstellung des Räumlichen zu Zeiten des historischen Roms. Ein ganz konkretes Beispiel für den Einsatz von Technologie zur Visualisierung von Raum und Architektur. Die Idee des Gründungsmythos übertrugen Tarik Goetzke und Anna Kubelík dann später auch auf Peking. Hier musste der Mythos sehr lange gesucht werden, da mit der Kulturrevolution in China die Geschichten und Sagen der Gründungsgeschichte von Peking fast vollständig verschwunden waren. Die Suche war eng verbunden mit der Auseinandersetzung mit Mythen und Geschichten und im Dialog mit lokalen darstellenden Künstler*innen.
Die Skulpturen-Serie Magic Lantern I & II, basierend auf Daniel Schnyders Komposition "Aladin" im Berliner Radialsystem (2011-2013). Die Arbeit wurde im Rahmen einer Einzelausstellung während eines Musikfestivals präsentiert. Schnyders Komposition umfasst 50 Schläge und 61 Noten, die auf sein Alter und Geburtsjahr verweisen. Diese Informationen wurden in eine Grafik transkribiert und dann in eine 3D-Zeichnung umgewandelt. Anhand der gesammelten Daten wurde eine Reihe von Skulpturen aus Holz und Acrylglas hergestellt. Die Partitur wurde in dreidimensionalen Struktur übersetzt, in eine Spirale. Entstanden sind daraus zwei Arbeiten, lasergecuttete Noten, die sich in Holzform aufeinanderstapeln lassen. Aufgrund ihrer spiralförmigen Geometrie dreht sich die Skulptur, wenn sie der Hitze von Kerzen ausgesetzt wird. Die Idee der drehende Mechanismen ergaben sich aus der traditionellen Gestaltung von Weihnachtspyramiden, deren thermodynamischen Eigenschaften und Simplizität.
Die vorgestellten Projekte entstanden allesamt durch Alltagsbeobachtungen – Reize, die dann Recherchen in Gang setzen. Inspirationen sammelt Anna Kubelík überall, durch Materialität, Bücher, Spielzeug. Kontext ist ihr dabei extrem wichtig, Recherche und der Austausch mit Menschen, Spielen und Experimentieren mit Maßstäben. Ein weiteres Tool ist die Methode des Spekulierens und des Zusammenarbeitens. Als Teil des Exzellenz-Clusters Matters of Activity HU Berlin ist sie daran interessiert, Grundlagen für eine neue Kultur des Materialen zu schaffen, im Zeitalter des Digitalen, das Analoge in der Aktivität von Bildern, Räumen und Materialien neu zu entdecken. Dabei verschränken sich Biologie und Technik, symbolische Formen und Material, Natur, Kultur und Architektur in neuartiger Weise.
Einen neuen Impuls für die Interdisziplinarität der Lehre an der HTWG, der sich aus dem Arbeiten im Exzellenz-Cluster ergeben hat, sieht Anna Kubelík im Begriff der spekulativen Architektur, der sich aus der bloßen Annahme ergibt. Eine Mutmaßung, zuerst vage, die sich zuspitzt durch Wissensanreicherung, Austausch und genaue Recherche. Über die Zukunft lässt sich nur spekulieren. Dies gelte auch für die Bedürfnisse zukünftiger Stadtbewohner*innen. Spekulation als Disziplin, als Designpraxis, die sich mit zukünftigen Designvorschlägen kritischer Natur befasst, mit dem Ziel, nicht kommerziell getrieben Designvorschläge zu unterbreiten. Vielmehr Vorschläge, um entscheidende Probleme zu identifizieren und zu diskutieren – und Konsequenzen und Implikationen der Beziehungen zwischen Wissenschaft, Technologien und Menschen untersuchen. Anna Kubelik möchte diese Idee stärker auch in den Kontext der Architektur stellen, und die Architekturbedürfnisse mit den Studierenden diskutieren. Die Interdisziplinarität mit den Bereichen Materialforschung und KI nimmt für sie dabei eine elementare Bedeutung ein.




Text: Tobias Stilz