Architektur
Bachelor und Master
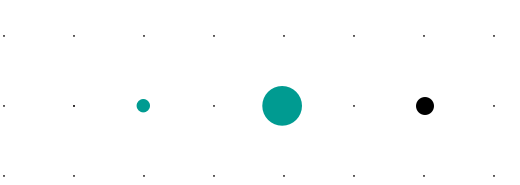
UmBauforschung – was hat Archäologische Bauforschung mit der Bauwende zu tun?

UmBauforschung – was hat Archäologische Bauforschung mit der Bauwende zu tun?
Prof. Andreas Schwarting berichtet in einem Vortrag aus seinem Forschungssemester an der ETH Zürich.
Im Wintersemester 2024/25 befand sich Professor Andreas Schwarting im Forschungssemester, in dem er sich intensiv mit dem Thema Bauwende auseinandersetzte. Forderungen wie Erhalt statt Abriss, Weiterbauen statt Neubau, Pflege statt Verschleiß, Nutzungsanpassung statt baulicher Anpassung kommen inzwischen aus der Architektenschaft selbst – schließlich ist bekannt, dass weltweit rund die Hälfte der CO₂-Emissionen auf den Gebäudesektor zurückgehen.
Für ihn stellte sich daher die Frage, welchen Beitrag die archäologische Bauforschung zur Bauwende leisten kann und welche Potenziale in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Bauforschung und Baupraxis liegen. Besonders interessierten ihn auch die Folgen für die Architekturlehre.
Mehr als die Hälfte des Gebäudebestandes in Deutschland stammt aus den Jahren 1949 bis 1990, davon der größte Teil aus den 1960er- und 1970er-Jahren. An dieser Zeitschicht wird sich das Gelingen der Bauwende entscheiden – eine gewaltige Herausforderung, gilt doch diese Epoche laut der Bundesstiftung Baukultur als besonders unbeliebt.
Als Gastwissenschaftler arbeitete er sechs Monate im Team von Silke Langenberg, Professorin für Konstruktionserbe und Denkmalpflege am Institut für Denkmalpflege und Bauforschung der ETH Zürich. Ein Highlight war ein Workshop auf der Schatzalp, dem nicht nur aus Thomas Manns „Zauberberg“ bekannten ehemaligen Lungensanatorium, das heute als Hotel genutzt wird und viele bauzeitliche Baustrukturen und Einrichtungsgegenstände bewahrt hat. Im Workshop „Repair Schatzalp – Keep in Place“ restaurierten Studierende unter Anleitung von Mitarbeitenden der Professur Langenberg sowie Handwerkern des RapLab der ETH mehrere Hotelzimmer und ein ehemaliges Chefarztzimmer. Schadhafte Möbel wurden repariert, überarbeitet oder durch vorhandenes Mobiliar aus dem Hotelfundus ersetzt. Dabei ging es weniger um stilistische Reinheit als um das gestalterische Zusammenspiel unterschiedlich erhaltener oder erneuerter Elemente. So konnten denkmalpflegerische Prinzipien wie Rekonstruktion, Ergänzung und Reparatur anschaulich diskutiert werden.
Weitere Exkursionen führten u. a. zum Dreispitz-Areal in Basel („Plan Guide“ von Herzog & de Meuron) sowie zu einer umgebauten Freikirche in Basel von Otto Rudolf Salvisberg, die vom Büro Beer März Architekten saniert und als Probebühne für das Sinfonieorchester Basel nutzbar gemacht wurde. Besonders eindrucksvoll war, wie bei der Ertüchtigung der Fensterrahmen und der Integration der bauzeitlichen Gläser in die neue Doppelverglasung denkmalpflegerische und energetische Standards in Einklang gebracht wurden.
Als Gastwissenschaftler konnte er an Buchvorstellungen, Vorträgen und Promotionsprüfungen teilnehmen. Bei einer Konferenz zum Thema „Transformationswerte gebauter Umwelt“ wurde der Frage nachgegangen, ob zusätzlich zu den herkömmlichen Denkmalwerten wie dem historischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Wert ein neuer »Transformationswert« zu etablieren ist.
Neben umfangreicher Literaturarbeit führte Prof. Schwarting zahlreiche Gespräche, unter anderem mit Prof. Ruggero Tropeano, mit dem er seit seiner Zeit an der Stiftung Bauhaus Dessau bekannt ist, und mit Prof. Annette Gigon vom Büro Gigon Guyer Architekten in Zürich, die sich intensiv mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigt. Weitere Begegnungen hatte er mit Prof. Eike Roswag-Klinge vom Natural Building Lab der TU Berlin, Präsidenten der Architektenkammer Berlin und Mitgründer des Büros ZRS Architekten Ingenieure, das auf zirkuläres Bauen spezialisiert ist, sowie mit Arnd Rose vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn, auf den er durch dessen Artikel „Bauwende braucht Bauforschung“aufmerksam wurde.
Für das Fazit zitierte er den schlicht mit „und“ überschriebenen Aufsatz von Wassily Kandinsky aus dem Jahr 1927, der das 19. Jahrhundert als Zeitalter des Ordnens und Zergliederns beschreibt – eine Entwicklung, die „Mauern“ errichtet habe. Kandinsky beklagt die Trennung von materieller und geistiger Welt und vieler weiterer Spezialisierungen und fordert stattdessen eine ganzheitliche Erschließung der Wirklichkeit.
Um zu veranschaulichen, was dieses „und“ heute bedeuten könne, bezog Prof. Schwarting sich auf das Gebäude G der HWTG Konstanz, einen typischen Bau der 1960er-Jahre, der nicht unter Denkmalschutz steht, aber durch zahlreiche bauzeitliche Details von hoher Qualität zeugt. „Um einen solchen Bau zu erhalten, ist Wissen um die Besonderheiten der Architektur und ihrer Konstruktionsdetails notwendig“, betont Schwarting. Er wünscht sich, dass zeitgenössische Lehrbücher, Baukataloge sowie neuere Untersuchungen digital zugänglich sein sollten.
Besondere Bedeutung misst er der Lehre bei. Die historische Bauforschung ist seit rund hundert Jahren institutionell verankert – etwa durch die Koldewey-Gesellschaft, eine kleine wissenschaftliche Akademie mit etwa 350 Mitgliedern, von denen sich jedoch nur rund 30 speziell mit Gebäuden der Nachkriegszeit beschäftigen. Daraus ergibt sich die Frage, wie diese Methodik und dieses Wissen nicht nur in spezialisierten Masterstudiengängen, sondern in der allgemeinen Architekturlehre nutzbar gemacht werden kann. Hier zeigt er nochmals eine einfache Dokumentationsmethode von Ruggero Tropeano: Auf Basis entzerrter Fotografien werden Ansichtspläne erstellt, in die jeweils Materialien, Farben und eine bauzeitliche Einordnung eingetragen werden können.
Am Ende zitiert er Prof. Hans-Rudolf Meier von der Bauhaus-Universität Weimar, der betont, dass Forschung wesentlich zur „Überlieferungsbildung“ beiträgt: Indem Hochschulen diese Zeitschicht stärker in der Lehre verankern, fördern sie das Verständnis und die Wertschätzung der Bauten jener Zeit. So könne sich langfristig ein neues Berufsbild in der Architektur entwickeln, das die Forschung ganz selbstverständlich mit einbezieht.
„Es gilt, forschende Neugier, konstruktive und kulturelle Kenntnisse sowie kreative Kompetenz zu entwickeln und zu fördern!“
Text: Cornelia Lurz
Bilder: Andreas Schwarting



