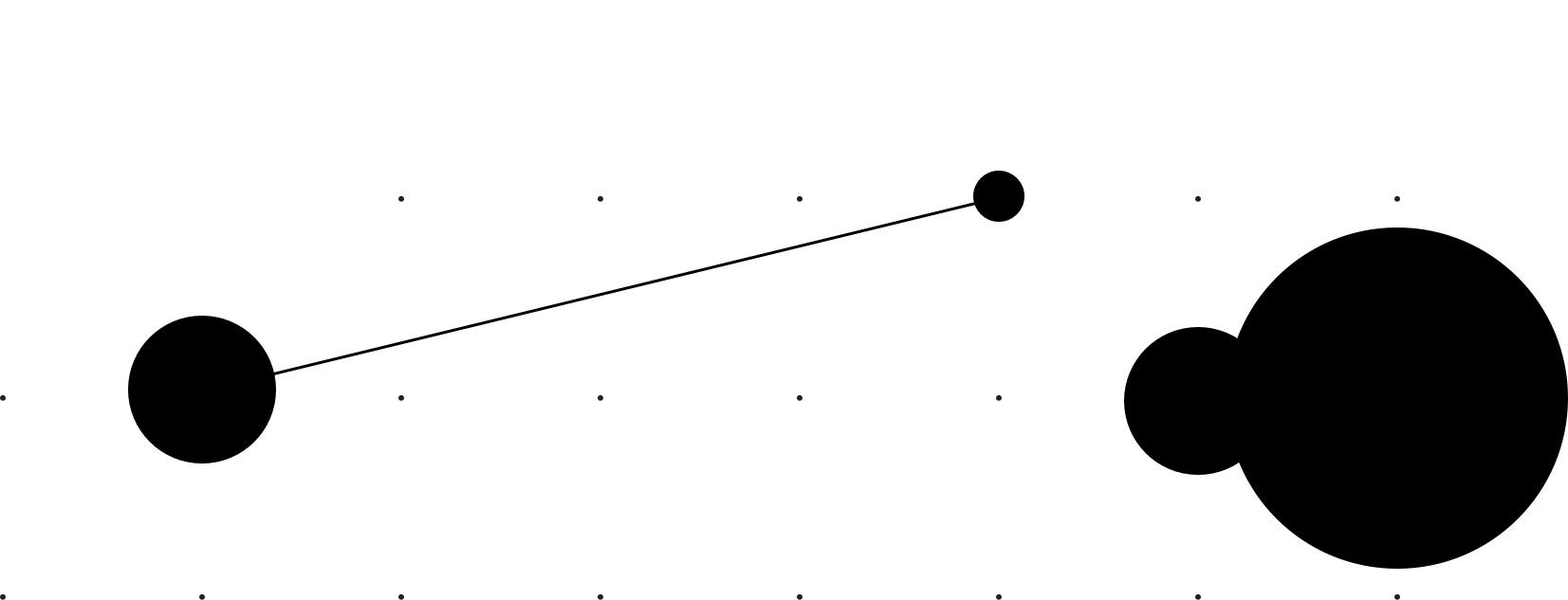Mit der AG Entrepreneurship wollen die Hochschulen aus der Vierländerregion Bodensee gemeinsam das hiesige Startup- und Gründungsökosystem stärken. Dazu sollen neue Analysen zu Anforderungen und Wirksamkeit durchgeführt sowie Angebote grenzübergreifend geschaffen werden. Zudem sollen Gründungsinteressierte und GründerInnen dazu befähigt werden, gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen anzupacken. Die HTWG ist mit dem IST Institut und der dort angesiedelten Startupinitiative Kilometer1 Teil der AG-Bereiche University-Corporate-Collaboration/Corporate-Startup-Collaboration, Marken- und Marketingstrategie sowie Evaluation.
In diesen Bereichen sollen im besagten Berichtszeitraum folgende zwei Forschungsarbeiten erfolgen:
(1) Untersuchung der Innovationsfähigkeit und -kultur von kleinen und mittleren Unternehmen in der Bodenseeregion. Im Zentrum der Untersuchung stehen die folgenden Forschungsfragen: Wie lassen sich die Innovationsaktivitäten der Unternehmen charakterisieren? Welche Formate dienen der Stärkung der Innovationsfähigkeit? Die Beantwortung dieser Fragen folgen einem Design Science Research Ansatz mit zwei Teilschritten: (i) Datenerhebung mittels einer Umfrage (Fragebogen) und deren statistische Auswertung (hinsichtliche u.a. Verteilung, Häufigkeit, Beziehungen) zu Bedarf und Status Quo der Unternehmen hinsichtlich Innovationsentwicklung sowie University-Corporate-Collaboration & Corporate-Startup-Collaboration; und (ii) Entwicklung von Formaten (Artefakte) mittels den empirisch gewonnenen Erkenntnissen und der Literaturanalyse zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Unternehmen und Startups.
(2) Untersuchungen, wie sich Formate der Gründungsförderung in der verteilten Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren des Gründungsökosystems effektiv gestalten und evaluieren lassen.
Dafür werden folgende Forschungsfragen gestellt: Was sind Gestaltungselemente für die Formate? Welche Koordinationsmechanismen sichern die bedarfsgerechte Durchführung der Formate? Was ist ein geeigentes Evaluationsvorgehen, das dynamische Anpassungen aus der Praxis mitberücksichtigt? Die Bearbeitung der Forschungsfragen folgt dem Ansatz der Evaluation durch Forschung und nutzt dafür Methoden wie Interviews für die Datenerhebung, Grounded Theory für die Datenauswertung sowie die Gioia-Methode zur Aggregation der Erkenntnisse zu den Gestaltungselementen, Koordinationsmechanismen und Vorgehensweisen.
Projektpartner: Universität Konstanz, Zeppelin Universität, HAW Kempten, OST Ostschweizer Fachhochschule

Prof. Dr. Guido Baltes
Direktor des Instituts für Strategische Innovation & Transformation (IST)
Raum G 341
+49 7531 206-310
gbaltes@htwg-konstanz.de