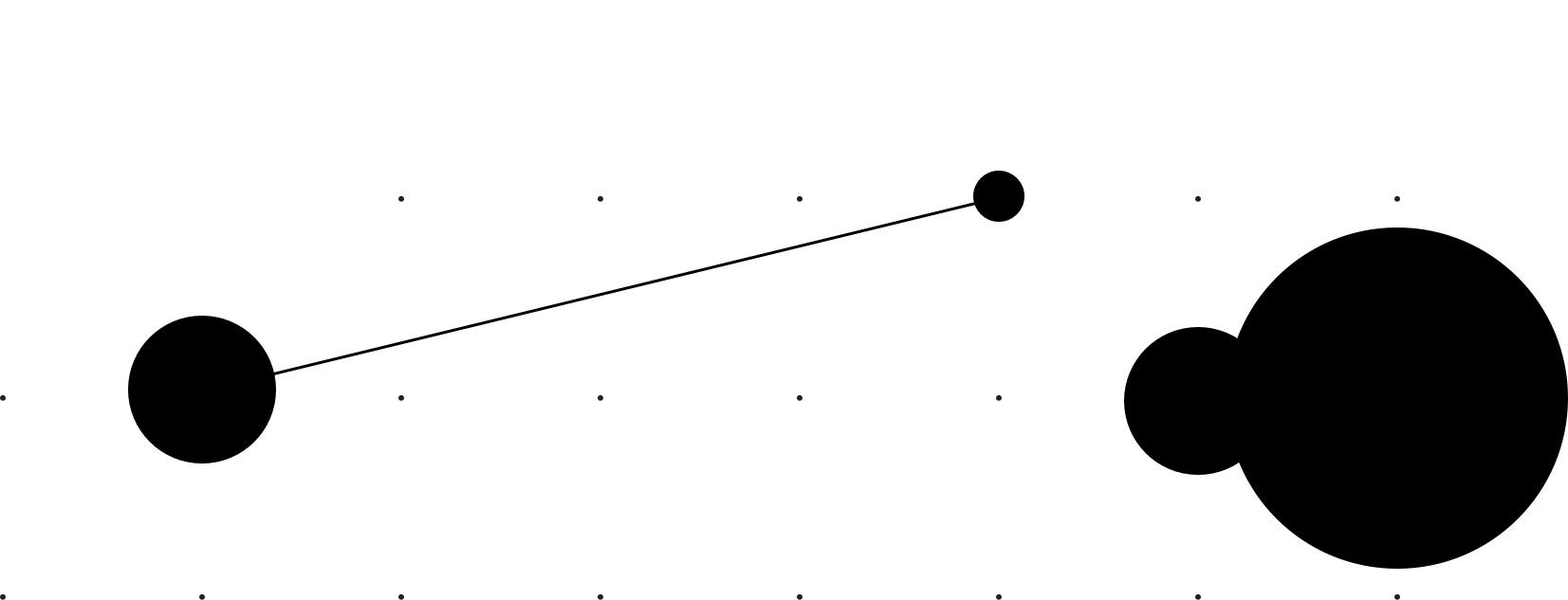Das Projekt „Nachhaltige Tourismusstrategien und -projekte für UNESCO-Welterbestätten, -anwärter und nationale Kulturerbestätten im Oman“ war auf zwei Jahre angelegt und wurde gemeinsam mit der German University of Technology in Maskat (GUTech) durchgeführt. Das Sultanat Oman hat den Tourismus als einen der wichtigsten Treiber für wirtschaftliche Diversifikation und ökologisch nachhaltige Entwicklung im Zuge der auch im Oman geplanten Abkehr von fossilen Brennstoffen identifiziert. Auf der Liste der UNESCO-Anwärterkandidaten stehen im Oman einige historische Stätten und Attraktionspunkte, die großes Potential haben, einem nachhaltigen Tourismus und somit einer nachhaltigen Regionalentwicklung zugute zu kommen. Der Weg hin zur offiziellen UNESCO-Anerkennung und einer langfristig nachhaltigen Tourismusdestination bedarf einer überlegten Entwicklungsstrategie, die die drei Säulen der Nachhaltigkeit – ökonomisch, ökologisch und sozial – berücksichtigt. Ein besonders drastisches Beispiel, bei dem diese Entwicklung aufgrund falscher oder ausbleibender Maßnahmen fehlgeschlagen ist, ist das „Arabian Oryx Sanctuary“ im Oman, das 2007 als erste Stätte überhaupt den Welterbestatus verlor.
Um dies künftig zu vermeiden und somit den nachhaltigen Tourismus und eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern, ist das Ziel des Projektes, dass durch Zusammenarbeit von (Nachwuchs-)wissenschaftler*innen und Student*innen der HTWG Konstanz und der GUTech sowie lokalen omanischen Akteur*innen aus der Tourismusbranche Projekte und Strategien entwickelt werden, um eine ganzheitlich nachhaltige Entwicklung von Welterbestätten voranzutreiben.
Im Fokus der Forschung steht hierfür unter anderem das Schildkrötenreservat „Ras al Hadd Turtle Reserve“, das gemeinsam mit der auf seinem Gebiet liegenden historischen Stätte „Ras al Jinz“ seit 2013 auf der Liste der Anwärterkandidaten für die UNESCO Welterbestätten steht. Darüber hinaus finden auch Nachhaltigkeitsprojekte zu bestehenden Welterbestätten und nationalen Kulturerbestätten im Oman Berücksichtigung, um von einer vergleichenden Analyse zu profitieren. Hierzu wurden eine Forschungskooperation zwischen Prof. Dr. Tatjana Thimm (Professorin für Tourismusmanagement) und Prof. Dr. Heba Aziz (Professorin für Nachhaltigen Tourismus und Regionalentwicklung) und den Arbeitsgruppen der beiden Professorinnen etabliert. Promovierende der HTWG Konstanz und der GUTech forschten im Rahmen dieses Projekts, insbesondere zur Welterbestätte „Festung von Bahla“.
Die Promovierenden der HTWG Konstanz, Florian Eitzenberger und Corinne Karlaganis sowie Prof. Dr. Tatjana Thimm haben im Februar und März 2024 Forschungsaufenthalte im Oman absolviert, die die Forschungskooperation der beiden Hochschulen weiter vertieften. Florian Eitzenberger hat im Februar und März 2024 den zweiten Teil seiner Feldforschung unternommen. Er führte hierzu Interviews mit lokalen Autoritäten von relevanten Welterbestätten für eine internationale Vergleichsstudie mit Usbekistan. Seine Forschungsarbeit trägt den Titel „Comparing Tourism Strategies at UNESCO World Heritage Sites in Oman und Uzbekistan - Case Study Bahla Fort and Itchan Kala“. Methodisch wendete er qualitative Experteninterviews und teilnehmende Beobachtung an. Folgendes Erkenntnisgewinnziel liegt seiner Forschungsarbeit zugrunde: Die World Heritage Convention von 1972 ist ein internationaler Vertrag mit dem Ziel, das natürliche und kulturelle Erbe der Menschheit für künftige Generationen zu bewahren. Aus diesem Vertrag leiten sich die Rahmenbedingungen ab, unter denen das UNESCO World Heritage Komitee arbeitet, Welterbestätten ernennt und bewertet. Der über 300 Seiten umfassende Vertrag wird in der Praxis jedoch oft von jeweiligen Ländern und Behörden unterschiedlich interpretiert und ausgelegt. Auch die Kommunikation zwischen der UNESCO und den lokalen Entitäten verläuft oft nach den Gegebenheiten vor Ort und resultiert in einem unterschiedlichen Management der Welterbestätten. Insbesondere bei der Erschließung der Welterbestätten für touristische Zwecke bestehen oft konträre Managementansätze, die dem Erhalt und der Bewahrung von Natur- oder Kulturerbe zuwiderlaufen können. In Florian Eitzenbergers Untersuchung sollten daher lokale Tourismusstrategien und -nutzungskonzepte an bereits etablierten Welterbestätten im Oman und in Usbekistan systematisch miteinander verglichen werden, um Implikationen für die praktische Auslegung der World Heritage Convention von 1972 sowie die touristische Erschließung von Welterbestätten durch lokale Stakeholder abzuleiten. Während ihres Forschungsaufenthaltes im Februar und März 2024 hat Corinne Karlaganis ihren Fokus auf die soziale Komponente von nachhaltigen Tourismusstrategien von Welterbestätten im Oman gelegt. In enger Zusammenarbeit mit der omanischen Partneruniversität GUTech hat sie weitere Datenerhebungen an den zwei Standorten Nizwa und Bahla durchgeführt mit dem Schwerpunkt des Einbezugs der lokalen Bevölkerung (insbesondere von Frauen) in nachhaltige Tourismusprojekte. Basierend auf Theorien zu „Community Based Tourism“ und „Empowerment“ durch Tourismus untersuchte sie die Fragestellung, wie die lokale Gemeinschaft, insbesondere Frauen, in den Kulturtourismus bei den beiden historischen Stätten einbezogen sind. Des Weiteren interessierte sie die Frage, ob der Einbezug von Frauen und marginalisierten Gruppen zu Formen von „Empowerment“ führt und welche Einflussfaktoren diesbezüglich relevant sind. Für ihre vergleichende qualitative Studie wendete Corinne Karlaganis semistrukturierte Leitfadeninterviews mit Expert*innen sowie Fokusgruppendiskussionen an. Die Interviewpartner wurden anhand des Schneeballprinzips identifiziert und ausgewählt. Interviews wurden aufgenommen und anonymisiert. Die Erkenntnisse sollen die Konzeption und Implementierung der sozialen Komponente in nachhaltige Tourismusstrategien für UNESCO- wie auch nationale Kulturstätten im Oman unterstützen. Dies wiederum ist für deren erfolgreiche und langfristige Umsetzung relevant. Prof. Dr. Tatjana Thimms Forschungsfrage, wie sich klimaneutraler Tourismus im Oman etablieren lässt, wurde empirisch untersucht. Die erhobenen Daten basieren auf quantitativen Erhebungen und einem qualitativen Mix aus Experteninterviews und teilnehmender Beobachtung. Die Erhebungen zur Zahlungsbereitschaft für CO2-Kompensation der Reise unter Touristen fanden wie 2023 auch 2024 im Souk von Muttrah in Maskat statt. Prof. Dr. Tatjana Thimm hat auch Experteninterviews mit zahlreichen Leitern von Welterbestätten und nationalen Kulturerbestätten geführt. Das folgende Erkenntnisgewinnziel liegt ihrer Arbeit zugrunde: Anhand von touristischen Beispielen im Oman (Welterbestätten, Welterbestättenanwärter, nationales Erbe) sollte untersucht werden, wie dort punktuell und beispielhaft Formen eines klimaneutralen Tourismus etabliert werden können.
Im Februar 2024 fand die von der GUTech organisierte internationale Konferenz „Opportunities for Heritage – Fostering Innovation, Conservation and Sustainability“ statt. Dies gab den HTWG Kolleg*innen die Möglichkeit, Vorträge zu halten und ihre aktuellen Forschungsprojekte vorzustellen. Der an der GUtech für das Projekt eingestellte Doktorand Mohamed Salama hat in diesem Rahmen die Digitalisierung der Welterbestätte Bahla präsentiert.
Darüber hinaus fand ein insgesamt dreitägiger gemeinsamer studentischer Workshop mit Studierenden der HTWG Konstanz und der GUtech zum Thema "Sustainable Tourism Management at World Heritage Sites (with a special focus on environmental, cultural and social aspects) and Intercultural Exchange“ statt. Der Schwerpunkt des Workshops lag auf Welterbestätten und nationalen Kulturerbestätten im Oman und in Deutschland und fand im Oktober und November 2024 statt. So wurde das bisher stark auf Ost- und Südasien ausgelegte Forschungs- und Lehrprofil der HTWG um eine westasiatische Perspektive erweitert und eine internationale Vernetzung von Studierenden und Doktorand*innen ermöglicht.